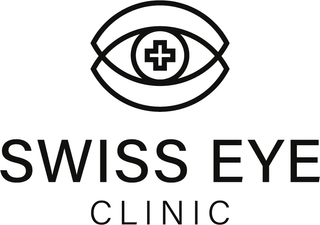Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Torische Linse – Was ist das und wozu dient sie?
Was genau ist Astigmatismus?
„Astigmatismus“ ist ein anderes Wort für „Stabsichtigkeit“ und „Hornhautverkrümmung“. Dabei handelt es sich um einen Brechungsfehler des Auges. Dieser Brechungsfehler entsteht, wenn das Auge an zwei Punkten das Licht unterschiedlich bricht. Die häufigste Form des Astigmatismus ist die Hornhautverkrümmung. Das Licht wird an unterschiedlichen Stellen gebrochen, da die Hornhaut eine ungewöhnliche Form besitzt. Ärzte sprechen auch von einem refraktiven Defekt. Dieser Defekt kann ebenfalls bei der Augenlinse und der Netzhaut auftreten.
Das Auge kann das Licht nicht einheitlich auf der Netzhaut fokussieren. Dadurch kommt es zur Fehlsichtigkeit. Objekte erscheinen auf zwei Punkten auf der Netzhaut anstatt auf einem Punkt. Dadurch sieht der Betroffene die Dinge verschwommen. Begleitende Symptome sind Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit. Generell unterscheidet man drei Haupttypen von Astigmatismus:
- kurzsichtiger Astigmatismus: Die Krümmung führt zu einer Kurzsichtigkeit
- hydropischer Astigmatismus: Die Krümmung führt zu einer Weitsichtigkeit
- gemischter Astigmatismus: Eines der Augen kann kurzsichtig sein, das andere ist weitsichtig.
Wie entsteht eine Hornhautverkrümmung und wer hat sie?
In der Tat haben sehr viele Menschen eine Hornhautverkrümmung. Viele von ihnen merken es nicht einmal. In solchen Fällen ist der Grad der Verkrümmung gering und es treten keine Symptome auf. Astigmatismus ist in der Regel angeboren und vererbbar. Solltest du Astigmatismus haben, dann haben deine Vor- und Nachfahren wahrscheinlich ebenfalls diese Verkrümmung der Hornhaut. Es gibt allerdings auch andere Ursachen. Krankheiten und Verletzungen können zu einer Veränderung der Hornhaut und zu einem refraktiven Defekt führen. Beim Keratokonus zum Beispiel wölbt sich die Hornhaut, bis eine Art Kegel entsteht. Ein Katarakt kann ebenfalls die Ursache einer Trübung der Hornhaut sein.
Wie sieht die Diagnose aus?
Der Augenarzt stellt die Hornhautverkrümmung auf dieselbe Weise fest, wie er auch die Kurzsichtigkeit und die Weitsichtigkeit diagnostiziert. Den Grad der Verkrümmung misst er mithilfe der Refraktionsbestimmung von Lichterscheinungen auf der Netzhaut. Man nennt diese Technik „Skiaskopie“ oder Schattenprobe.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
Wie wird das Auge behandelt?
Zur Behandlung von Astigmatimus kommen zwei Mittel infrage: Kontaktlinsen, sogenannte „torische Linsen“ oder ein operativer Eingriff. Bei der operativen Astigmatismuskorrektur verändert der Chirurg die Hornhaut mit einem Laser. Jedoch ist ein Eingriff zumeist nicht erforderlich. Kontaktlinsenträger können auf torische Linsen zugreifen.
Welche Kontaktlinsen helfen bei Stabsichtigkeit?
Beim Astigmatismus verordnet der Augenarzt eine spezielle Kontaktlinse, die „torische Linse“. Diese Linsen sind besonders gut für die Korrektur der Hornhaut geeignet. Ähnlich wie torische Brillengläser verfügen sie über einen eingeschliffenen Zylinder, der auf die individuelle Verkrümmung der Hornhaut ausgerichtet ist. Jede Hornhautverkrümmung ist anders, daher verschreibt der Augenarzt individuelle torische Kontaktlinsen. Während normale Kontaktlinsen eine Kugelform haben, sind die torischen Linsen derart geformt, dass durch die besondere Form der torischen Linsen zwei unterschiedliche Brechwerte entstehen. Dadurch kommt die Korrektur der Hornhautverkrümmung zustande. Bei der anschliessenden Nachkontrolle überprüft der Arzt, ob die torische Linse die Krümmung richtig korrigiert. Augenärzte verschreiben diese Linsen mitunter auch bei der Behandlung des Grauen Stars.
Welche Arten von torischen Linsen gibt es? Tages- oder Monatslinsen?
Nicht nur helfen torische Linsen bei der Fehlsichtigkeit, sie lassen sich auch so anpassen, dass sie die Augen bei Weitsichtigkeit oder Kurzsichtigkeit unterstützen. Solche Kontaktlinsen nennen sich „torische Multifokallinsen“. Damit ist das brillenfreie Sehen in die Ferne selbst mit einer Verkrümmung der Hornhaut problemlos möglich. Nur für das Sehen in der Nähe brauchen die Betroffenen noch immer eine Brille.
Die Linsen lassen sich an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Es gibt Tageslinsen und Monatslinsen, Linsen aus weichem und aus hartem Material. Wichtig ist nur, dass die Linsen von einer Person aus dem Fach angefertigt werden. Sollten die Linsen nicht an die individuelle Verkrümmung der Hornhaut angepasst sein, verfehlen sie ihren Zweck. Ausserdem muss das Pflegemittel zu der Art der Linse passen. Monatslinsen und Tageslinsen sowie weiche und harte Materialien haben unterschiedliche Ansprüche.
Wie setze ich die torischen Linsen richtig ein?
Torische Linsen verfügen über spezielle Stabilisatoren. Diese Stabilisatoren gewährleisten den korrekten Sitz auf der Hornhaut. Sitzen sie nicht richtig, dann brechen die Linsen das Licht nicht korrekt. Die Linse verfügt über dünne und dicke Bereiche sowie über gerade geschnittene Kanten und eine unterschiedliche Gewichtsverteilung. Jede torische Linse ist anders, wie jede Hornhautverkrümmung anders ist. Wie du die Linse korrekt einsetzt, hängt letztlich von ihrer speziellen Beschaffenheit ab. Daher muss der Arzt jeden Kontaktlinsenträger individuell einweisen.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Kleine Pupillen – Ursachen und Hintergründe
Die Augen sind der Spiegel der Seele. Das zeigt sich auch in der Pupillengrösse. Ein Schönheitsideal waren seit jeher grosse und erweiterte Pupillen, wobei einige Menschen früher auch mit Belladonna nachhalfen. Heute erweitert ein Augenarzt die Pupille mit Augentropfen, um eine bessere Diagnose stellen zu können. Sind die Pupillen dagegen klein, kann die Ursache auch in einer Erkrankung liegen. Alles zum Thema gibt es hier.
Multifokale Linse: Vorteile vor allem bei der Alterssichtigkeit
Du leidest an einer Alterssichtigkeit, möchtest aber keine Gleitsichtbrille tragen? In diesem Fall ist die multifokale Linse die ideale Lösung für dich. Etwa ab einem Alter von 45 Jahren trifft es beinahe jeden und die Fähigkeit, Dinge in der Nähe zu erkennen, nimmt stetig ab. Man spricht in diesem Fall von der Alterssichtigkeit, die mit einer Gleitsichtbrille meist gut korrigiert werden kann. Leider verträgt nicht jeder diese Brille; die Folgen für viele Patienten sind Kopfschmerzen oder Schwindel. Mit der multifokalen Linse aber profitierst du von einem brillenfreien Alltag.
Augenmuskulatur – Aufbau und Funktion
Die Augenmuskulatur hat wichtige Aufgaben und ermöglicht die gesamte Bewegung des Augapfels. Das wiederum macht ein optimales Sehen möglich, da durch die Muskeln eine blitzschnelle Reaktion und das Drehen des Augapfels in alle Richtungen gelingen. Die Anatomie und der Aufbau der Muskulatur sind komplex und Augenmuskeln und die Augenmuskelnerven können auch geschädigt werden. Die Augenheilkunde unterscheidet zwischen Erkrankungen der Muskeln und denen der Muskelnerven. Alles zur Augenmuskulatur haben wir dir hier zusammengestellt.
Keratokonus – die wichtigsten Informationen über die Hornhauterkrankung
In der Schweiz gibt es etwa 5000 Patienten, die an dieser Augenkrankheit leiden. Die meisten von ihnen sind Männer, aber auch Frauen können daran erkranken. Es handelt sich dabei um ein vermutlich erblich bedingtes Leiden: der Keratokonus. Für die Betroffenen ist dies eine störende Verformung der Hornhaut, die sie im Alltag stark behindern kann. Falls du schon einmal mit dieser Krankheit in Berührung gekommen bist, hast du dir sicher viele Fragen gestellt. In diesem Artikel werden die sieben wichtigsten Fragen zum Keratokonus beantwortet.
Sjögren Syndrom – was hat es mit der Autoimmunerkrankung auf sich?
Die chronisch verlaufende Autoimmunerkrankung namens Sjögren-Syndrom ist nicht sehr bekannt. Verständlich also, dass du zahlreiche Fragen dazu hast. Das Sjögren-Syndrom ist eine entzündlich-rheumatische Erkrankung und gehört zu der Gruppe der Kollagenosen. Das bedeutet: Eine bestimmte Art der Immunzellen greift die Speicheldrüsen und die Tränendrüsen an. Das wiederum führt zu Entzündungen an inneren Organen und am zentralen Nervensystem. Trockene Augen und ein trockener Mund gehören zu den Symptomen, die auch als Sicca-Syndrom bezeichnet werden. Benannt ist die Erkrankung nach dem schwedischen Augenarzt Dr. Henrik Sjögren. Er beschrieb sie erstmals 1933.
Nahakkomodation und Fernakkomodation – alles über die Flexibilität der Augenlinse
Damit du Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung wahrnehmen kannst, muss dein Auge Nahakkommodation und Fernakkommodation beherrschen. Andernfalls würdest du immer nur Dinge in der gleichen Entfernung scharf sehen und der Rest der Welt wäre ein verschwommen. Doch wie schafft das Auge eine solch beeindruckende Leistung und welche Folgen können Störungen der Akkommodationsfähigkeit nach sich ziehen? Antworten auf diese und viele andere Fragen findest du hier.