Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Nahakkomodation und Fernakkomodation – alles über die Flexibilität der Augenlinse
Was bedeutet Akkommodation?
Das Sehen ist ein physikalischer Prozess, wobei das Auge wie eine Linse funktioniert. Eine scharfe Abbildung wird üblicherweise auf der Netzhaut (Retina) erzeugt, indem die reflektierten Lichtstrahlen von der Oberfläche eines Objekt zunächst über die äussere Hornhaut des Auges (Cornea) und danach durch die Augenlinse gebrochen werden. Die gebrochenen Strahlen treffen dann auf der Netzhaut wieder zusammen. Damit du etwas scharf siehst, müssen die Lichtstrahlen in einem ganz bestimmten Punkt auf die Netzhaut treffen. Da das Auge die Bildweite – dabei handelt es sich um den Abstand zwischen Augenlinse und Netzhaut – nicht anpassen kann, bleiben zur Scharfstellung nur zwei Optionen:
- Veränderung der Gegenstandsweite: die Entfernung des Gegenstands zum Auge.
- Anpassung der Brennweite: Ändert sich die Wölbung der Augenlinse, verändert sich auch ihre Dicke. Dies hat zur Folge, dass die Lichtstrahlen anders gebrochen werden. Diesen Vorgang bezeichnet man als Akkommodation.
Bis zu einem bestimmten Abstand zur Gesichtslinie ist das Auge in der Lage, Objekte ohne Akkommodation scharf zu sehen. Diesen Punkt bezeichnet man als Fernpunkt. Im Gegensatz zum Fernpunkt beschreibt der Nahpunkt die kürzeste Gegenstandsweite. Diese Punkte liegen bei jedem Menschen anders.
Wie funktionieren Nahakkommodation und Fernakkommodation?
Die Akkommodation ist eine dynamische Veränderung der Brechkraft der Augenlinse. Erzeugt wird sie durch den Ziliarmuskel, der die Linse umgibt, sowie der Zonulafasern. Sie sind die Verbindungsfasern zwischen Ziliarmuskel und Linse. Je nachdem, ob Objekte in der Nähe oder Ferne scharfgestellt werden sollen, gibt es zwei Varianten der Akkommodation:
- Nahakkommodation: Sind Objekte in der Nähe von Interesse, zieht sich der Ziliarmuskel zusammen, wodurch die Zonulafasern erschlaffen. Die Augenlinse besitzt eine Eigenelastizität und krümmt sich durch diese Zugkraft. Dadurch nimmt die Brechkraft des Auges zu.
- Fernakkommodation: Hier muss der Ziliarmuskel sich für die Ferneinstellung des Auges wieder entspannen. Die Zonulafasern wirken entgegengesetzt und ziehen sich zusammen. Die Wölbung der Augenlinse nimmt ab und die Brechkraft verringert sich.
Wie lange braucht das Auge für Nahakkommodation und Fernakkommodation?
Insgesamt benötigt das Auge etwa eine Sekunde, um sich auf die jeweilige Entfernung einzustellen. Die Latenzzeit, die Zeit zwischen dem Stimulus und der eigentlichen Muskelkontraktion, beträgt rund 0,36 Sekunden. Die restliche Zeit bleibt für die eigentliche Akkommodation, also die Kontraktion oder Entspannung von Ziliarmuskel und Zonulafasern.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
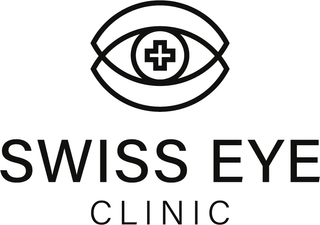 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 Zürich0 Bewetungen0449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 * -
 Zürich
ZürichVista Augenklinik Seefeld
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich0 Bewetungen0442... Nummer anzeigen 044 266 60 90 -
 Zürich
ZürichVista Augenpraxis Talwiesen
Birmensdorferstrasse 318, 8055 Zürich0 Bewetungen0444... Nummer anzeigen 044 463 63 63
Welche Faktoren stimulieren den Ziliarmuskel?
Nahakkommodation und Fernakkommodation verlaufen nicht willkürlich. Damit das Gehirn Gegenstände scharf erkennen kann, müssen die reflektierten Lichtstrahlen auf die Fovea centralis treffen. Dabei handelt es sich um den Bereich des schärfsten Sehens auf der Netzhaut. Wenn der Gegenstand exakt auf diesen Bereich trifft, wird der Ziliarmuskel durch einen entsprechenden Stimulus angeregt, um die Brechkraft anzupassen.
Welchen Einfluss hat die Brechkraft der Augenlinse auf das Sehvermögen?
Die Masseinheit für die Brechkraft ist die Dioptrie. Hierbei handelt es sich um die Veränderungsfähigkeit der Augenlinse während der Akkommodation. Das menschliche Auge kann im Durchschnitt während der Nahakkommodation und der Fernakkommodation Veränderungen zwischen 15 und 27 Dioptrien abdecken. Die Differenz der Veränderung nennt man auch Akkommodationsbreite. Im Durchschnitt besitzt das Auge also eine Akkommodationsbreite von zwölf Dioptrien. Je elastischer die Augenlinse, desto stärker die Brechkraft und damit auch die Akkommodationsbreite.
Wie verändert sich die Akkommodationsbreite im Laufe des Lebens?
Im Laufe deines Lebens verändert sich die Akkommodationsbreite, da sich auch die Augenlinse verändert. In jungen Jahren ist sie noch elastisch und flexibel. Kleinkinder besitzen eine Akkommodationsbreite von etwa 14 Dioptrien. Das Linsenmaterial verhärtet jedoch mit zunehmendem Alter stetig.
Welche Störungen der Akkommodationsfähigkeit können auftreten?
Verschiedene Störungen können bei Nahakkommodation und Fernakkommodation auftreten. In der Regel wird dann versucht, die fehlende Brechkraft mit einer Brille oder Kontaktlinsen auszugleichen. Zu den Störungen gehören:
- Alterssichtigkeit (Presbyopie):Wie bereits erwähnt nimmt die Elastizität der Augenlinse im Alter ab. Die Alterssichtigkeit setzt ein, wenn die Akkommodationsbreite unter 4 Dioptrien fällt. Sie beginnt ab dem 45. Lebensjahr und verstärkt sich dann zunehmend. Betroffene können auf kurze Entfernungen Objekte nicht mehr scharf wahrnehmen. Von der Alterssichtigkeit sind mehr als 600 Millionen weltweit betroffen.
- Kurzsichtigkeit (Myopie): In diesem Fall kann das Auge trotz maximal abgeflachter Augenlinse Objekte in grosser Entfernung nicht scharf stellen, da der Brennpunkt sich vor der Netzhaut befindet. Wenn das Objekt näher an das Auge herangeführt wird, haben kurzsichtige hingegen keine Schwierigkeiten.
- Weitsichtigkeit (Hyperopie): Hier liegt trotz Akkommodation der Brennpunkt hinter der Netzhaut. Den Betroffenen fällt es schwer auf kurze Entfernung scharf zu sehen. Kinder machen im Laufe ihrer Entwicklung eine Phase der Weitsichtigkeit durch, diese verliert sich im Normalfall jedoch später wieder.
- Ziliarmuskelverspannung: Die Akkommodation ist ein Kraftaufwand für das Auge, den du nicht wahrnimmst. Muss der Ziliarmuskel über einen längeren Zeitraum, eine Akkommodation auf konstanter Entfernung aufrechterhalten, kann es zu einem Muskelkrampf kommen. Die Symptome sind Müdigkeit, verschwommen Sehen und eine vorübergehende Kurzsichtigkeit. Der Zustand kann bis zu 60 Minuten andauern.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Die Dioptrien-Skala für die optische Brechungswirkung der Brille
Es gibt unterschiedliche Formen der Fehlsichtigkeit, die das Tragen einer Sehhilfe notwendig machen. Viele Menschen bevorzugen eine Brille, andere Kontaktlinsen. Um die Brillengläser an die Sicht des Trägers anzupassen, spielt die Dioptrien-Skala eine wichtige Rolle, die alle Dioptrienwerte enthält und ein einheitliches System zur Messung darstellt.
Kataraktoperationen gegen Grauen Star – Fragen und Antworten
Ein „Katarakt“ oder „Grauer Star“ beschreibt die Trübung der Augenlinse. Wenn sich die Linse des Auges eintrübt, dann nimmt die Sehleistung ab und die Person sieht wie durch einen grauen Schleier. Mithilfe von Kataraktoperationen lässt sich die Sehfähigkeit der Augenlinse gänzlich oder zumindest beinahe wiederherstellen. Alles zum Thema erfährst du in unserem hilfreichen FAQ.
Rot Grün Schwäche: Wenn Grün und Rot fast gleich aussehen
Sie ist die häufigste Störung unter den Sehschwächen: Eine angeborene Rot Grün Schwäche kommt in fast jeder Familie vor – meist bei Männern. Warum die Farbfehlsichtigkeit eine Männerdomäne ist, welche Formen es gibt und wie sie den Alltag beeinflussen kann, haben wir in den FAQs rund um die Sehstörung zusammengetragen.
Augeninfarkt – was versteht man darunter und wie muss man damit umgehen?
Die Medien und die Presse erörtern den Herzinfarkt und die möglichen Folgen ausgiebig. Warum hörst du fast nie etwas über einen Augeninfarkt? Die Ursachen sind bei beiden Infarkten ähnlich. Durch Unwissenheit lassen sich die Symptome eines Augeninfarkts nicht erkennen. Deine Augenprobleme nimmst du nicht ernst und verschiebst den Besuch beim Augenarzt. Eine verzögerte Therapie ist für die Schäden einer Durchblutungsstörung am Auge fatal. Der Augeninfarkt ist nicht zu unterschätzen. Besonders bei Personen ab 50 steigt das Risiko. Wir informieren über Ursachen, Symptome und Therapie bei einem Augeninfarkt.
Augendruck messen – Verschiedene Wege, um den Augeninnendruck zu messen
Ein erhöhter Augeninnendruck kann viele Ursachen haben, von denen einige gefährlich werden können. So kann beispielsweise ein Glaukom (auch Grüner Star genannt) vorliegen. Doch nicht bei jeder Form des Glaukoms gibt es einen erhöhten Augendruck. So entsteht bei einem Normaldruckglaukom oder Niederdruckglaukom kein Innendruck im Auge. Bei einem Offenwinkelglaukom sieht dies wiederum anders aus, da hierbei ein deutlich spürbarer Druck im Auge zu vernehmen ist. Ein Glaukom früh zu erkennen, ist für dein Wohlbefinden unerlässlich. Wir zeigen dir, wie sich der Augeninnendruck am besten individuell messen lässt, und welche weiteren Mittel dir zur Verfügung stehen.
Glaskörpertrübungen – Antworten zu einem meistens ungefährlichen Phänomen
Früher oder später fallen sie jedem auf: Kleine Flecken in unserem Sichtfeld, Punkte, die nicht weggehen und sich über unser Auge schlängelnde Fäden. Dabei handelt es sich nicht um eine optische Täuschung, sondern um eine Trübung des Auges. Solche Glaskörpertrübungen sind kein ungewöhnliches Phänomen. In den meisten Fällen sind ihre Ursachen vollkommen harmlos. Sie können aber auch auf Erkrankungen hinweisen. Wir erklären dir, wann ein Besuch beim Augenarzt ratsam sein könnte.
