Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Epiretinale Fibroplasie: Definition, Diagnose und Behandlung
Was ist eine epiretinale Fibroplasie?
Die epiretinale Fibroplasie ist eine Häutchenbildung auf der Makula. Die Makula ist dabei eine Membran an der Netzhaut, die sich primär um die Sehschärfe kümmert. Bei einer epiretinalen Fibroplasie wird durch die Häutchenbildung die Netzhaut verzogen. Vergleichen kannst du dieses Verziehen mit Falten wie in einem Leintuch. Die Ursachen für diese Erkrankung sind unterschiedlich:
- Sie kann primär nach einer vorausgegangenen Augenkrankheit entstehen. Oft passiert dies altersbedingt durch eine Störung bei der Abhebung des Glaskörpers. Dieser Vorgang wird Glaskörperabhebung genannt.
- Auf sekundärer Basis nach Eingriffen am Auge, dazu gehört auch das Augenlasern, kann es ebenfalls zu dieser Erkrankung kommen.
Was ist eine epiretinale Gliose?
Bei der Gliose verformt sich der gesamte Glaskörper des Auges, wodurch die Makula mit einem sich bildenden Häutchen versehen wird. Diese Krankheit entsteht in der Regel erst bei Patienten über 50 Jahren. Die entstandene Membran durch das Häutchen reduziert das Sehvermögen und es kann zu Kurzsichtigkeit oder zur starken Abnahme der Sehfähigkeit kommen.
Welche Symptome gibt es bei einer epiretinalen Fibroplasie?
Erste Symptome bei einer epiretinalen Fibroplasie nimmst du beim Lesen wahr, weil die Linien der Buchstaben verzerrt werden. Zudem kann es sein, dass du in der Mitte deines Blickfeldes einen schwarzen Fleck, also nicht deine Umgebung, siehst. In einigen Fällen sind die Symptome jedoch auch kaum merklich und werden oft mit einer Weitsichtigkeit gleichgesetzt. Dabei kann es sich unter anderem um verschwommenes Sehen handeln.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
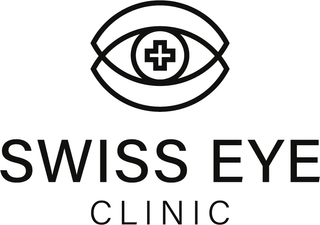 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 Zürich0 Bewetungen044 923 04 04 0449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 044 923 04 04 * -
 Zürich
ZürichVista Augenklinik Seefeld
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich0 Bewetungen044 266 60 90 0442... Nummer anzeigen 044 266 60 90 044 266 60 90 -
 Zürich
ZürichVista Augenpraxis Talwiesen
Birmensdorferstrasse 318, 8055 Zürich0 Bewetungen044 463 63 63 0444... Nummer anzeigen 044 463 63 63 044 463 63 63
Wo befindet sich die Makula und welche Funktion hat sie?
Die Makula, auch gelber Fleck genannt, ist ein Bereich im hinteren zentralen Teil der Netzhaut des Auges. Durch diese verläuft die Sehachse, sodass sie zentral für die Sehfähigkeit gebraucht wird. Die Funktion dieses Teils des Körpers ist vor allem dazu da, dass du Objekte scharf sehen und fokussieren kannst. Das entspricht dem zentralen Gesichtsfeld, das durch die Schädigung der Makula fortschreitend verringert wird – deine Sehkraft schwindet.
Was passiert mit der Netzhaut bei einer epiretinalen Fibroplasie?
Die Netzhaut deines Auges beziehungsweise deiner Augen wird durch die Bildung des Häutchens an der Makula verformt. Es gibt dabei unterschiedliche Formen der Entwicklung.
- Schichtforamen: Für ein Schichtforamen muss noch keine Gliose stattgefunden haben. Es handelt sich dabei eher um einen Defekt der Makula an der Netzhaut. Dadurch schreitet die eigentliche Erkrankung langsam voran.
- Pseudoforamen: Durch die Verformung der Netzhaut entsteht bei diesem Krankheitsbild eine lochartige Form. Entsprechend verändert sich die Substanz der Netzhaut, sie wird jedoch nicht verdünnt. Daher trägt diese Erkrankung auch den Namen „Pseudo".
- Durchgreifendes Makulaforamen: Diese Krankheit ist mit einer Netzhautablösung zu vergleichen. Der Glaskörper zieht durch das entstandene Häutchen an der Makula, sodass das Gewebe zwischen dem Glaskörper und der Makula reisst. Diese Art schreitet sehr schnell fort, sodass du sie an einer schnellen Abnahme der Sehschärfe erkennst.
Wann kommt es bei einer epiretinalen Fibroplasie zur Operation?
Im Normalfall kann keine Art der epiretinalen Fibroplasie alleine abheilen. Eine Operation ist spätestens dann sinnvoll und angebracht, wenn du als betroffene Person im Alltag durch fehlende Sehschärfe stark eingeschränkt bist. Hast du jedoch nur wenige Symptome oder Schmerzen, wird der Krankheitsverlauf erst einmal beobachtet, bevor eine Operation infrage kommt. Generell orientieren sich Ärzte daran, erst zu operieren, wenn die Sehstärke auf unter 40 Prozent fällt. Das kann jedoch von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Die Operation selbst erfolgt meist in Vollnarkose auf stationärer Ebene oder ambulant mit einer lokalen Betäubung.
Welche Folgen hat eine epiretinale Fibroplasie für das Auge?
Wird eine epiretinale Fibroplasie durch eine Operation behandelt, werden die Verzerrungen, die durch die Krankheit entstehen, gemindert beziehungsweise verbessert. Inwieweit sich die Sehschärfe bessern kann, ist je nach Art der Fibroplasie und individuellen Eigenschaften unterschiedlich. Bei einer epiretinalen Fibroplasie liegt die Prognose bei einem Zugewinn der Sehkraft bei der Hälfte der bereits verlorenen. Wenn du dementsprechend 30 Prozent an Sehkraft verloren hast, können durch die Operation wieder 15 Prozent hinzugewonnen werden. Sowohl bei den Schichtforamen als auch bei den Makulaforamen lässt sich keine genaue Prognose stellen. Es geht hier eher darum, eine fortschreitende Verschlechterung zu minimieren. Bleibt eine epiretinale Fibroplasie unbehandelt, wirst du mit der Zeit stetig an Sehkraft verlieren. Deine Wahrnehmung wird verzerrt sein, sodass dir das Lesen und Erkennen von Symbolen und Buchstaben dadurch erschwert wird.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Orthoptiker – womit beschäftigt sich dieser Berufszweig?
Orthoptiker sind auf einem wichtigen Gebiet der Augenheilkunde tätig und kümmern sich um Prävention, Diagnose und Therapie unterschiedlicher Sehstörungen und Augenerkrankungen von Kindern und Erwachsenen. Das Auge gehört zu den fünf Sinnesorganen der Menschen und bedarf einer besonders behutsamen Behandlung. In diesem Ratgeber beantworten wir die häufigsten Fragen rund um das Thema Orthoptik und erklären, wann und weshalb die orthoptische Untersuchung besonders sinnvoll ist.
Augenschmerzen und ihre Ursachen
Während Sehstörungen oft mit anderen Erkrankungen und Beschwerden zusammenhängen, haben Augenschmerzen ihren Ursprung oftmals im Auge und in der Augenhöhle selbst. Augenschmerzen sind nicht einfach zu orten und wirken teilweise wie eine Migräne. Dabei treten mit dem Schmerz auch Einschränkungen der Sicht auf. Daher ist eine Untersuchung beim Augenarzt nötig, um die Ursache zu klären.
Augenringe wegbekommen mit System – eine Anleitung
Mit der Frage, wie du deine Augenringe wegbekommen kannst, bist du nicht allein. Es ist ein Thema, mit dem sich viele Menschen täglich aufs Neue beschäftigen. Die dunklen Schatten unten den Augen lassen das Gesicht oft müde und nicht selten auch älter wirken. Wie du Schritt für Schritt an der Beseitigung von Augenringen arbeitest und dabei auch deine Gesundheit verbesserst, zeigen wir dir in der folgenden Anleitung auf unserer beliebten Vergleichsplattform für die Schweiz.
Blindenschrift: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Dass zum Lesen und Schreiben nicht immer die Augen benötigt werden, beweist die Blindenschrift. Hier erfährst du, was die Blindenschrift genau ist, welche Schriftarten es gibt und wie sie funktioniert.
Blinder Fleck und die Auswirkung auf das Sehen
In der Netzhaut und im Bereich des Sehnervs ist eine Stelle vorhanden, die keinerlei optische Reize weiterverarbeiten kann. An dieser Stelle entsteht der blinde Fleck, der jedoch vom Sehenden nicht wahrgenommen wird. Das Gehirn ist in der Lage, alle bildverarbeitenden Prozesse auszugleichen und die fehlenden Sehinformationen zu ergänzen. Am blinden Fleck lässt sich gut erkennen, wie sich das menschliche Auge entwickelt hat.
Ekzem am Augenlid: Die wichtigsten Infos auf einen Blick
Dein Auge ist gerötet und geschwollen? Du entdeckst kleine Bläschen? Das kann ein Ekzem am Augenlid sein: Die unangenehme Entzündung der Haut kommt vergleichsweise häufig vor. Sie betrifft sowohl Frauen als auch Männer – und lässt sich auf viele verschiedene Ursachen zurückführen. Wir verraten dir, weshalb du beim Verdacht auf eine Dermatitis auf jeden Fall zum Arzt gehen solltest und was du im Rahmen der Hautpflege tun kannst, um den lästigen Juckreiz zu lindern.
