Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Hypophysenadenom – Ursache unbekannt, Behandlung möglich
Was ist ein Hypophysenadenom?
Ein Hypophysenadenom ist eine von vielen Hirntumorerkrankungen, das sich etwa ab dem 35. Lebensjahr bemerkbar machen. Es betrifft den Schädel und die Hirnanhangsdrüse. Letztere hat im Körper die Funktion, Hormone und Botenstoffe zu bilden. Dazu besitzt sie Drüsenzellen. Die Erkrankung besteht in einem gutartigen Tumor, der an jeder dieser Drüsenzellen auftreten kann. Teil des Krankheitsverlaufs ist häufig eine Überproduktion der Hormone.
Auch wenn die Ursachen, die zu einem Hypophysenadenom führen, nicht bekannt sind, steht fest, dass der Tumor aus einer entarteten Zelle entsteht und den Hypophysenvorderlappen an der Hirnanhangsdrüse betrifft. Entartet heisst dabei, dass sich eine Zelle nicht auf normale Weise entwickelt. Die typischen Regelmechanismen, durch die eine Zelle gebildet wird, wächst, sich teilt oder abstirbt, sind gestört. Möglich ist eine erbliche Ursache, darunter das MEN-1-Syndrom. In Verbindung mit dem Hypophysenadenom kommt es bei Patienten oft auch zu einer Überfunktion der Nebenschilddrüse oder zu Krebs an der Bauchspeicheldrüse.
Welche Formen der Erkrankung gibt es und welche Hormone sind betroffen?
Die Hirnanhangsdrüse befindet sich in einer Region, die sich als Mulde in der Schädelbasis zeigt. Hier geschieht die Ausschüttung deiner Hormone, durch die wiederum wichtige Körperfunktionen gesteuert werden, darunter die Aktivität deiner Schilddrüse. Die Hypophysentumore sind gutartig, wachsen jedoch im Verlauf der Erkrankung. Sie werden in hormonaktive und hormoninaktive Hypophysenadenome unterschieden und verursachen verschiedene Auswirkungen auf die Organe sowie eine unkontrollierte Ausschüttung der Hormone. Betroffen sind:
- Prolaktin (Hormon, das die Milchproduktion innerhalb der weiblichen Brustdrüse nach der Geburt reguliert)
- GH (Wachstumshormon)
- ACTH (Hormon, das die Ausschüttung von Kortison reguliert)
Welche Symptome und Sehstörungen treten bei einem Hypophysenadenom auf?
Der Krankheitsverlauf und das Wachstum des Tumors geschehen sehr langsam, sodass ein Hypophysenadenom meist erst spät bemerkt und diagnostiziert wird. Einfluss hat der Tumor in Abhängigkeit davon, wo er sich in deinem Schädel befindet. Dann kann es auch zu gefährlichen Symptomen kommen. Bemerkbar macht sich die Erkrankung häufig durch:
- Sehstörungen
- Muskellähmungen
- Kopfschmerzen
- Übelkeit und Erbrechen
- Wasserkopf
Sehstörungen äussern sich als Störungen des Gesichtsfelds und eine Sichtverschlechterung. Du erkennst deine Umwelt nur eingeschränkt oder nimmst sie verschwommen wahr.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
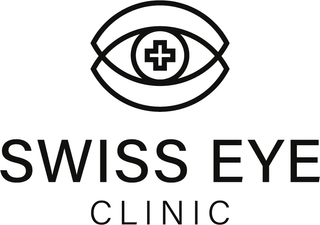 Zürich
ZürichSwiss Eye Clinic
Dufourstrasse 47, 8008 Zürich0 Bewetungen044 923 04 04 0449... Nummer anzeigen 044 923 04 04 044 923 04 04 * -
 Zürich
ZürichVista Augenklinik Seefeld
Holbeinstrasse 25, 8008 Zürich0 Bewetungen044 266 60 90 0442... Nummer anzeigen 044 266 60 90 044 266 60 90 -
 Zürich
ZürichVista Augenpraxis Talwiesen
Birmensdorferstrasse 318, 8055 Zürich0 Bewetungen044 463 63 63 0444... Nummer anzeigen 044 463 63 63 044 463 63 63
Wie betrifft der Hypophysentumor die Sehnerven?
Erst wenn der Tumor auf die Sehnerven drückt, entwickeln sich bei einem Hypophysenadenom diverse Sehstörungen. Das betrifft besonders Gesichtsfeldausfälle, eine verschwommene Sicht oder Doppelbilder. Diese Sehstörungen müssen dabei nicht kontinuierlich auftreten. Manchmal hast du wechselnde Phasen, siehst wieder klar und normal, bis das Sehvermögen kurzzeitig wieder abnimmt. Durch die Sehnerven leitet die Netzhaut die Signale an das Gehirn weiter. Liegen Störungen an den Sehnerven vor, kommt es daher zu Wahrnehmungsproblemen. Wächst der Tumor stark, kannst du sogar erblinden.
Wie werden Hormone in der Hirnanhangsdrüse gebildet?
Die Hirnanhangsdrüse wird durch den Hypothalamus beeinflusst und erhält ihre Signale über dieses übergeordnete Zentrum. Das ermöglicht die Bildung von sechs unterschiedlichen Hormonen, die wiederum andere Körperhormondrüsen anregen. Wichtige sind die Nebenniere und die Schilddrüse, die auch eigene Hormone bilden. Ist die Ausschüttung durch einen Tumor gestört, fällt diese zu hoch oder zu niedrig aus und verursacht Beschwerden. Auch wenn die Ursache ein Hypophysenadenom ist, bezeichnet die Medizin die einzelnen Krankheitsbilder noch einmal gesondert. Zu ihnen gehören:
- Prolaktinom
- Akromegalie
- Morbus Cushing
Wie wird ein Hypophysenadenom diagnostiziert?
Bei einem Verdacht auf ein Hypophysenadenom ist die Zusammenarbeit verschiedener Fachärzte notwendig. Die Neurochirurgie übernimmt die Operation, um den Tumor zu entfernen. Vorab fertigt jedoch ein Radiologe eine Computertomografie an, um herauszufinden, wo der Tumor im Schädel sitzt. Die CT gestattet ausserdem, die Grösse des Tumors zu erkennen. Ein Neurologe wiederum untersucht dich, wenn du Kopfschmerzen hast oder eventuelle Muskellähmungen auftreten. Sehstörungen werden von einem Augenarzt behandelt. Wichtig ist die Untersuchung deiner Beschwerden beim Endokrinologen. Dieser findet heraus, welche Hormone betroffen sind und untersucht entsprechend dein Blut, deinen Urin und deinen Speichel.
Welche Möglichkeiten einer Behandlung gibt es in der Neurochirurgie?
Ein Hypophysenadenom ist schwierig zu diagnostizieren und zeigt auch nicht zwingend Symptome. Oft genügt eine Untersuchung, die in bestimmten Zeitabständen erfolgt und kontrolliert, ob der Hypophysentumor sich vergrössert hat. Die Prognose sieht dann teilweise gut aus, wenn die Sehnerven nicht zu stark involviert sind.
Eine Therapie setzt der Arzt individuell an. Machbar ist eine Behandlung mit Medikamenten, mit Bestrahlung oder Operation. Bei einer Operation versucht die Neurochirurgie den Tumor vollständig zu entfernen. Sie wird über die Nase durchgeführt, sodass keine Narben entstehen. Hat das Hypophysenadenom jedoch bereits eine bestimmte Grösse erreicht, muss es vorher durch Bestrahlung verkleinert werden. Die Neurochirurgie setzt die Operation dann bei Bedarf an. Wenn umliegende Strukturen, Nerven oder Gefässe verletzt werden, wird eine weitere Therapie und Behandlung notwendig.
Der Augenarztvergleich für die Schweiz. Finde die besten Augenärzte in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Augenärzte
Das könnte dich auch interessieren
Grosse Pupillen können unterschiedliche Ursachen haben
Landläufig herrscht die Meinung vor, wer grosse Pupillen habe, hätte illegale Substanzen zu sich genommen. Häufig trifft dies auch zu. Drogen- oder Medikamentenmissbrauch ist die häufigste Ursache für grosse Pupillen – bei weitem aber nicht die einzige. Im Mittelalter galten grosse Pupillen bei Frauen als besonders schön. Sie träufelten sich vor einem Rendezvous aus diesem Grund Saft aus Tollkirschen, das Atropin enthält, in die Augen. Viele spannende Fragen rund um das Thema grosse Pupillen beantworten wir hier.
Augenentzündungen: Diagnose, Umgang und Behandlung
Gerötete Augen, Juckreiz und Schmerzen an den Augen sind keine Seltenheit. Weltweit haben etwa 40 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Augenentzündung im Jahr. Die oft unschönen Anzeichen dafür verunsichern die Menschen, sind jedoch in der Regel schnell unter Kontrolle. Da die Vielfalt der Entzündungen an den Augen jedoch so gross ist, solltest du dich konkret über deinen Fall informieren. Unterschiedliche Diagnosen erfordern daher einen anderen Umgang und schliesslich auch eine andere Behandlung. Die wichtigsten Fragen zum Thema Augenentzündungen beantworten wir dir hier.
In sieben Schritten die Augenfarben ändern
Die Vererbung der Augenfarbe wird durch mehr als nur ein Gen kontrolliert. Die Regenbogenhaut des Auges wird in ihrer Farbgebung durch den Farbstoff Melanin bestimmt. Fast alle Menschen haben als Säugling zunächst blaue Augen. Der Grund: Die Farbstoffe sind noch nicht in grösserer Menge vorhanden. Mit dem Heranwachsen bildet sich dann die Augenfarbe heraus. Je höher der Melaninanteil ist, desto tiefer und dunkler wird die Iris. Abhängig ist die Farbe auch von der Stimmung und der Gesundheit. Moderne Methoden in der Augenheilkunde gestatten eine Veränderung des Farbtons. Wie das geht, erfährst du hier.
Augenkrebs: Wichtige Fragen und Antworten
Der Augenkrebs gehört zu den seltenen Formen der Krankheit. Tritt er jedoch auf, dann ist es von höchster Wichtigkeit, dass du so schnell wie möglich die passende Behandlung erhältst. Im folgenden Artikel erfährst du alles Wichtige zum Thema Augenkrebs – welche Arten es gibt, wie der Augenarzt ihn entdeckt und wie der Behandlungserfolg aussieht.
Pupillendistanz – Schlüsselfaktor für die Fertigung individueller Brillen
Für den Kauf einer Brille sind ein Sehtest und eine Augenvermessung wichtig. Die ermittelten Werte ermöglichen die Fertigung der korrekt angepassten Brillengläser und werden in einem Brillenpass festgehalten. Ein entscheidender Wert ist die Pupillendistanz in Millimeter: Bei den wenigsten Menschen ist der Abstand zwischen Nasenrücken und Pupillenmittelpunkt gleich. Die Pupillendistanz gibt den Wert für deine Augen an und gestattet so die optimale Zentrierung der Brille.
Was Blut im Auge bedeuten kann: Fragen und Antworten
Wer Blut im Auge bemerkt, ist zunächst in der Regel schockiert. Schliesslich erinnern blutunterlaufene Augen an Szenen aus einem Horrorfilm. Die gute Nachricht: Nur in seltenen Fällen müssen Betroffene sich ernsthafte Sorgen um ihre Gesundheit machen. Unterschätzen solltest du Blut im Auge trotzdem nicht, weil manchmal eine unentdeckte Grunderkrankung dafür sorgt, dass die Augen gerötet sind. Lies hier nach, was es mit dem Blut im Auge auf sich hat, ob eine Krankheit hinter der Blutung steckt und wie du die Rötung bekämpfst.
